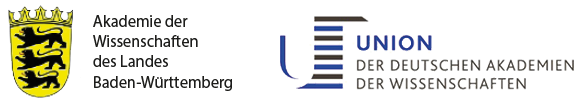Organisationseinheit
Akademie-Kolleg
Historisches Seminar
Geschichte des Mittelalters
Schloßstraße 8
49074 Osnabrück
Ausgewählte Publikationen und Vorträge
Eine vollständige Übersicht der Publikationen finden Sie hier (pdf). Zahlreiche Aufsätze sind online zugänglich auf der academia.edu-Seite von Christoph Mauntel
Monographien
Gewalt in Wort und Tat. Praktiken und Narrative im spätmittelalterlichen Frankreich (Mittelalter-Forschungen 46), Ostfildern 2014.
Die Erdteile in der Weltordnung des Mittelalters: Asien – Europa – Afrika (Monographien zur Geschichte des Mittelalters), Stuttgart 2023.
Ausgewählte Herausgeberschaften
Geography and Religious Knowledge in the Medieval World, hg. von Christoph Mauntel (Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung. Beihefte 15), Berlin/Boston 2021.
A World of Empires. Claiming and Assigning Imperial Authority in the Middle Ages, hg. von Chris Jones, Christoph Mauntel und Klaus Oschema (thematic issue of The Medieval History Journal 20/2 (2017)), Los Angeles et al. 2017.
Ausgewählte Aufsätze
The T-O Diagram and its Religious Connotations – a Circumstantial Case, in: Geography and Religious Knowledge in the Medieval World, hg. von Christoph Mauntel (Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung. Beihefte 14), Berlin/Boston, S. 57–82.
Die Bewältigung der Welt. Bevölkerungsgröße und Besiedlungsdichte als Erfassungskriterien lateinisch-christlicher Autoren des Spätmittelalters, in: Zeitschrift für Historische Forschung 46, 2019, S. 443-481.
Zusammen mit Klaus Oschema, Jean-Charles Ducène und Martin Hofmann: Mapping Continents, Inhabited Quarters and The Four Seas. Divisions of the World and the Ordering of Spaces in Latin-Christian, Arabic-Islamic and Chinese Cartography in the Twelfth to Sixteenth Centuries. A Critical Survey and Analysis, in: Journal of Transcultural Medieval Studies 5/2, 2018, S. 295–367.
Linking Seas and Lands in Medieval Geographic Thinking during the Crusades and the Discovery of the Atlantic World, in: Entre mers – outre mer. Spaces, Modes and Agents of Indo-Mediterranean Connectivity, hg. von Nikolas Jaspert und Sebastian Kolditz, Heidelberg 2018, S. 107-128.
Zusammen mit Andreas Büttner, Zählt auch Klio? Messen und Verstehen in der Geschichtswissenschaft, in: Messen und Verstehen in der Wissenschaft: Interdisziplinäre Ansätze, hg. von Marcel Schweiker et al., Heidelberg 2017, S. 43-55.
Zusammen mit Jenny Rahel Oesterle, Wasserwelten. Ozeane und Meere in der mittelalterlichen christlichen und arabischen Kosmographie, in: Wasser in der mittelalterlichen Kultur/Water in Medieval Culture. Gebrauch – Wahrnehmung – Symbolik/Uses, Perceptions, and Symbolism, hg. von Gerlinde Huber-Rebenich/Christian Rohr/Michael Stolz (Das Mittelalter, Beihefte 4), Berlin/Boston 2017, S. 59-77.
Projekt im WIN-Kolleg "Vermessen und Verstehen der Welt durch die Wissenschaft" (2014-2017)
Im Rahmen des WIN-Projekts „Die Vermessung der Welt“ wurde untersucht , welche Rolle dem Messen und Zählen als Beschreibungsmethode und Erklärungsmodell bei der Erfassung der Welt im mittelalterlichen Europa zukam. Das Projekt wurde in enger Verbindung mit dem Habilitationsprojekt des Antragstellers erarbeitet. Zahlreiche Ergebnisse liegen publiziert vor (s.o.), eine umfassende Datenbank wurde angelegt und wird weiter fortgeführt. Inhaltlich hat sich gezeigt, dass das Thema der quantitativen Erfassung deutlich mehr Bereiche der mittelalterlichen Lebenswelt umfasst, als nur die Geographie. Während eine umfassende Bearbeitung wünschenswert wäre, bedingt der Projektansatz doch eine thematisch beschränkte Analyse auf einzelne Fälle.