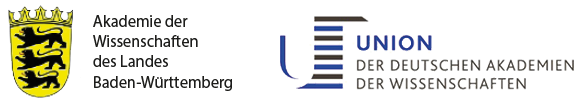Laufzeit: 2010 bis 2022

Nachdem im Jahre 332 v. Chr. Alexander der Große Ägypten erobert und 306 v. Chr. sein ehemaliger General Ptolemaios die Dynastie der Ptolemäer begründet hatte, setzte überall im Land ein gewaltiges Tempelbauprogramm ein, dessen Wurzeln vielleicht schon in die 30. Dynastie (380–342 v. Chr.) zurückreichen und das bis in das dritte nachchristliche Jahrhundert andauern sollte.
Die wegen ihres erweiterten und zudem speziellen Hieroglyphensystems bisweilen schwierigen Inschriften dieser späten Tempel enthalten umfangreiche, vielfältige und nicht selten einzigartige Informationen über Kult- und Festgeschehen, über die religiöse Topographie des Nillandes, Mythen und Göttergruppen, Baugeschichte und Raumfunktionen und werden deshalb von manchen Ägyptologen zu Recht als „Bibliotheken aus Stein“ bezeichnet.
Neben zahlreichen wünschenswerten Studien zu Einzelthemen fehlte bislang insbesondere ein systematischer Gesamtüberblick zu Kerninhalten, interner Vernetzung, Gestaltungsmustern sowie überlieferungsgeschichtlichen Problemen der bis ins Detail durchkomponierten ptolemäisch-römischen Tempeldekoration. Dieses Desiderat durch eine schrittweise auf Vollständigkeit ausgelegte inhaltliche und strukturelle Erschließung der griechisch-römischen Tempelinschriften zu beheben, war ein wesentliches Ziel des Heidelberger Akademieprojektes. Damit verknüpft war die Frage, ob die Tempel einen verbindlichen Bestand an Textgattungen erkennen lassen, der für die ägyptische Religion eine Art Kanon bildet.
Obgleich sich das Projekt vordringlich mit den ptolemäischen und römischen Tempeltexten beschäftigte, kam ihm mit dieser Aufgabe eine Brückenfunktion zu den anderen Bereichen der Ägyptologie zu: Die Analyse der Texttradition trug dazu bei, diese Tempeltexte weit mehr als dies bislang der Fall ist, in das Fach zu integrieren und von einem speziellen zu einem selbstverständlichen Gebiet der Ägyptologie zu machen. Die Arbeit der Forschungsstelle konnte zum 31.12.2022 erfolgreich abgeschlossen werden.