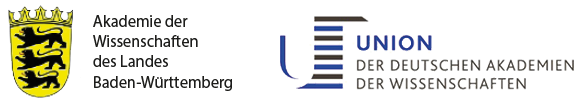Laufzeit: 2010 bis 2024
Das Projekt „Klöster im Hochmittelalter. Innovationslabore europäischer Lebensentwürfe und Ordnungsmodelle“ analysierte mittelalterliche Klöster als Wegbereiter der Moderne. Zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert entwickelten Klöster innovative Lebensformen und dienten als Vermittler zwischen Abgeschiedenheit und gesellschaftlichen Dynamiken.
Zwei vernetzte Arbeitsstellen an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig trugen das Projekt. In Heidelberg wurden Texte aus dem 12. und 13. Jahrhundert erforscht, die theologische und erzählerische Inhalte neu ordneten und visionäre Konzepte einer „besseren“ Welt schufen.
Ziele:
(a) Neue Editionen zentraler Quellen der religiösen Lebenswelt des Mittelalters (mit deutschen Übersetzungen der lateinischen Werke).
(b) Inhaltliche Auswertung der Texte unter kulturwissenschaftlichen und neuen methodischen Aspekten.
Projektleiter der Heidelberger Forschungsstelle: Prof. Dr. Bernd Schneidmüller und Prof. Dr. Stefan Weinfurter (gest. 2018)
Projekte
Teil A:
Gerhoch von Reichersberg stellte im 12. Jahrhundert in seinem Werk „Über das Bauwerk Gottes“ (Opusculum de aedificio Dei) eine Vision vor, in der alle Kleriker nach apostolischem Vorbild unter einer Regel leben. Seine radikalen Forderungen untermauerte er mit Zitaten aus kanonistischen und patristischen Autoritäten. Das Wissen darüber entnahm er den Rechtssammlungen seiner Zeit. Die Neuedition des Werkes bietet eine moderne kommentierte Aufbereitung mit deutscher Übersetzung und einer kritischen Auswertung der zitierten Autoritäten.
Julia Becker (Hg.), Gerhoch von Reichersberg, Opusculum de aedificio Dei. Die Apostel als Ideal (Edition, Übersetzung, Kommentar), KAI 8, 2020, 936 Seiten.
Infos unter: https://digi.hadw-bw.de/view/kai8
Identitätsstiftende Leitlinien für die regularkanonikale Lebensweise vermittelt das Scutum canonicorum („Schild der Kanoniker“), das Arno, Gerhochs Bruder und Dekan in Reichersberg, in der Mitte des 12. Jahrhunderts verfasste. Diese zentrale Quelle erscheint nun erstmals in einer kritisch kommentierten Edition mit deutscher Übersetzung.
Julia Becker (Hg.), Arno von Reichersberg, Scutum canonicorum (Edition, Übersetzung, Kommentar), KAI 11, 2022, 256 Seiten. Infos unter: https://digi.hadw-bw.de/view/kai11
Projektteil A.1
(Johannes Büge; bis Mai 2023 Dr. Julia Becker)
Johannes Büge arbeitete an der Edition, Übersetzung und Kommentierung des Anticimenon ("Widerrede") von Anselm von Havelberg. In diesem um 1149/50 verfassten Werk thematisiert Anselm die Einheit des Glaubens und regt zum Dialog zwischen Ost- und Westkirche an. Ziel ist eine moderne Neuausgabe dieser geschichtstheologischen Schrift, welche in den Kontext von Anselms Gesamtwerk und der Institutionalisierungsphase des Prämonstratenserordens eingebettet wird.
Anselms Schriften befassen sich zudem mit der regularkanonikalen Lebensweise und ihrem gesellschaftlichen Stellenwert im 12. Jahrhundert, wodurch sie die im Projektteil A.1 bereits erschienenen Neueditionen ergänzen.
Projektteil A.2
(Jonas Narchi M.A., M.A.)
Herr Jonas Narchi M.A., M.A. hat eine kritische Edition, Übersetzung und Kommentierung der Epistola apologetica Anselms von Havelberg (1138-1146) erstellt. In diesem Verteidigungsbrief rechtfertigt Anselm den Stand der Regularkanoniker angesichts von Kritik der Mönche. Anlass war ein Vorfall in der Diözese Halberstadt, bei dem Petrus, Propst des Stiftes Hamersleben, ins Benediktinerkloster Huysburg eintrat, was zu einem Streit zwischen Kanonikern und Benediktinern führte. Anselm verteidigt in diesem Brief vehement die Lebensweise der Regularkanoniker und das spezifische Charisma des ordo canonicus. Die Edition des Briefes trägt dazu bei, das Selbstverständnis verschiedener religiös-sozialer Lebensformen im 12. Jahrhundert zu rekonstruieren und fügt sich hervorragend in die Arbeiten von Projektteil A.1 ein.
Jonas Narchi (Hg.), Anselm von Havelberg, Epistola apologetica. Edition, Übersetzung, Kommentar, KAI 13), 2024, 264 Seiten.
Infos unter: www.schnell-und-steiner.de
Teil B:
Auf der Suche nach der idealen Gemeinschaft fand der Dominikaner Thomas von Cantimpré im 13. Jahrhundert Inspiration bei den Bienen. In seinem „Bienenbuch“ (Bonum universale de apibus) beschrieb er Hierarchien und soziale Dynamiken anhand der Bienen, angereichert mit Anekdoten aus dem mittelalterlichen Leben. Sein Handbuch unterstützte die Arbeit der Dominikaner als Prediger und Lehrer und fand schon im Mittelalter großes Interesse, wie die über hundert handschriftlichen Kopien zeigen. Erstmals ist das „Bienenbuch“ in einer kritisch kommentierten Edition mit deutscher Übersetzung und einer Analyse erschienen.
Julia Burkhardt, Von Bienen lernen. Das Bonum universale de apibus des Thomas von Cantimpré als Gemeinschaftsentwurf (Analyse, Edition, Übersetzung, Kommentar), KAI 7, 2020, 1.616 Seiten.
Infos unter: https://digi.hadw-bw.de/view/kai7
Projektteil B.1
(Bearbeiterin: Isabel Kimpel M.A. / wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Julia Burkhardt)
Der Zisterzienser Caesarius von Heisterbach (ca. 1180–1240) ist vor allem als Autor des Dialogus miraculorum bekannt. Eine weitere Exempelsammlung, die „Acht Wunderbücher“ (Libri VIII miraculorum, ca. 1225/27), hat weniger Beachtung gefunden. Diese Libri VIII miraculorum sind jedoch eine bemerkenswerte Quelle für die politische, kulturelle und religiöse Geschichte des 13. Jahrhunderts und dienen der theologischen Erbauung und Unterweisung. Die Neu-Edition der „Acht Wunderbücher“ bietet eine kommentierte Fassung des lateinischen Textes, erstmals eine deutsche Übersetzung sowie eine Auswertung des Werkes und seiner handschriftlichen Überlieferung. Sie erscheint 2025 beim Verlag Heidelberg University Publishing.
Projektteil B.2
(Dr. Volker Hartmann, abgeschlossen 2019)
Im Zentrum der Projektarbeit steht die Schrift "De regimine principum" des Aegidius Romanus (ca. 1243-1316). Das Werk entstand nahe der Verurteilung des Aristotelismus an der Pariser Universität 1277. Trotz des Adressaten (Philipp IV.) und obwohl es als Fürstenspiegel bekannt ist, wurde es europaweit auch außerhalb der Höfe rezipiert und übersetzt. Mit mehreren hundert Handschriften zählt es zu den meist tradierten Schriften des Spätmittelalters.
Der Erfolg des Textes, der bis ins 17. Jahrhundert anhielt, ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass der Autor ethisch relevante Teile der aristotelischen Philosophie zusammenfasste. Diese Anforderungen richteten sich an Fürsten und ihre Untertanen. Die Überlegungen zu den Amtskompetenzen des Königs stehen teilweise im Widerspruch zu den Aussagen in seiner späteren Schrift "De ecclesiastica potestate" (ca. 1302), die die päpstliche Universalherrschaft unterstützt.
Ziel ist die Bereitstellung einer modernen Gesamtübersetzung und der Transkription einer ausgewählten Handschrift.
Aegidius Romanus: Über die Fürstenherrschaft (ca. 1277-1279), nach der Handschrift Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. borgh. 360 und unter Benutzung der Drucke Rom 1556 und Rom 1607, hg. von Volker Hartmann, Heidelberg: heiBOOKS, 2019, 1.313 Seiten.
https://books.ub.uni-heidelberg.de/heibooks/catalog/book/569
Die Arbeitsstelle Dresden (Projektleiter: Prof. Dr. Gert Melville)
Die Arbeitsstelle in Dresden untersucht Klöster und Orden als Generatoren der Moderne. Im Mittelpunkt steht die vita religiosa und ihr Beitrag zu europäischen Ordnungsmodellen, indem sie die Beziehung von Individuum und Gemeinschaft sowie Rationalität und transzendente Sinnorientierung neu definierten. Das Schrifttum des 11. bis 13. Jahrhunderts wird rechtlich und Hortativ analysiert.
Texte, bei denen die kulturelle Deutungsmacht der Klöster programmatisch greifbar wird, stehen im Vordergrund: Mahnschriften, didaktische Traktate, Kloster- oder Ordensregeln und Statuten sowie deren Kommentare, welche die Rechtsordnung der Gemeinschaften bestimmten. Diese Schriften sollten nach innen wirken, standen jedoch auch immer in Bezug zur Welt.