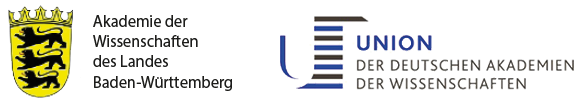Projektziele
Vorrangiges Ziel des Projekts ist die Erarbeitung eines historisch-philologischen Kommentars zur Chronik des Johannes Malalas. Mit diesem Kommentar soll ein Arbeitsinstrument vorgelegt werden, das den Zugang zum Werk erleichtert und eine fundierte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihm ermöglicht.
Das Projekt geht von den letzten Büchern der Chronik aus (beginnend mit dem 18. Buch), da sie die Zeitgeschichte behandeln. In diesem Zusammenhang ist neben dem Quellenwert des Textes für diese Zeit (d.h. für die Jahre 491-565) besonders die Haltung des Autors zu den einzelnen Kaisern zu diskutieren, ferner seine Art der Darstellung zentraler Ereigniskomplexe, die Gewichtung der erzählten Begebenheiten sowie die Bedeutung der Chronik im Gesamt-zusammenhang der Historiographie des 6. Jh.
Die Chronik des Johannes Malalas soll somit zum einen mit dem historisch-philologischen Instrumentarium traditioneller Quellenkritik sowie im Rahmen der Text-Kontext-Analyse untersucht und beschrieben werden, wobei nach Autor, Werk, Gattung, Verwendung von Topoi, Quellen usw. gefragt wird; zum anderen wird es darum gehen, das Werk in einer erweiterten Perspektive im Gesamt-zusammenhang der Memorialkultur im Oströmischen Reich des 6. Jh. – und darüber hinaus – zu verankern, um dadurch neue Erkenntnisse nicht nur über das Werk, sondern auch über die Gesellschaft zu gewinnen, deren integraler Bestandteil es ist.
Forschungsstand
Bis in die 80er Jahre des 20. Jh. hinein wurde die Chronik des Johannes Malalas in weiten Teilen der Forschung als ein von einem ungebildeten Mönch verfasstes Werk minderer literarischer Qualität angesehen. Selbst nachdem erwiesen worden war, dass es sich bei der Verbindung von Mönchtum und mangelnder Bildung um einen Fehlschluss handelte, wurde Malalas’ Chronik weiterhin vernachlässigt oder nur in Einzelaspekten gewürdigt, ohne dass eine fundierte Gesamtbeurteilung vorgelegt worden wäre.
Einen Meilenstein in der Malalas-Forschung stellen die Arbeiten des australischen Malalas-Teams dar, das – neben einer englischen Übersetzung – 1990 einen grundlegenden Sammelband vorlegte. Dieser beinhaltet neben einem Überblick zu Autor und Werk auch weiterführende Studien, die wichtige Impulse für die Beschäftigung mit Malalas gegeben haben.
Johannes Malalas und seine Chronik
Über die Person des Johannes Malalas ist nur sehr wenig bekannt. Er wurde wohl um 490 n. Chr. in Antiocheia in Syrien (h. Antakya, Türkei) oder dessen Umgebung geboren. Entgegen anders lautenden Forschungsmeinungen war er höchst wahrscheinlich kein Mönch, sondern wirkte in der Reichsverwaltung. Eher zu bezweifeln ist auch, dass Johannes Malalas dem Miaphysitismus zuneigte, wie man verschiedentlich aus dem Werk erschlossen hat.
Seine 18 Bücher umfassende Chronik stellt das älteste erhaltene Beispiel einer byzantinischen Weltchronik dar und bietet damit singuläre Einblicke in die Frühphase einer literarischen Gattung, die für das byzantinische Mittelalter zentrale Bedeutung besessen hat. Für die moderne Forschung ist dieses Werk aus mehreren Gründen von hoher Relevanz: Zum einen stellen die letzten drei Bücher, die die vom Autor selbst erlebte Zeit behandeln, eine wichtige Quelle für die Geschichte des 6. Jh. dar. Ihre besondere Relevanz für die althistorische Forschung ist allerdings erst in den letzten Jahren allmählich erkannt worden; seitdem hat sich Malalas’ Chronik als fundamentales zeitgenössisches Referenzwerk etabliert. Sie ermöglicht zudem zahlreiche Einblicke in kultur- und mentalitätsgeschichtlich relevante Aspekte, die über die sonst erhaltenen Quellen – vor allem die klassizistische Profanhistoriographie – nicht gewonnen werden können. Zum anderen besitzt die Chronik großen Wert für Fragestellungen, die auf die Entstehung und Entfaltung christlicher Geschichtsschreibung sowie allgemein der christlichen Memorialkultur der Spätantike zielen. Schließlich lassen sich aus dem Werk auch wichtige Erkenntnisse über die Konzeption von Vergangenheit durch einen christlichen Autor im Oströmischen Reich des 6. Jh. gewinnen.

Die Weltchronik beginnt mit Adam und der Erschaffung der Welt und bricht kurz vor dem Tod Kaiser Justinians (565) ab. Ob dieses Ereignis den ursprünglichen Endpunkt des Werkes dargestellt hat bzw. darstellen sollte, ist umstritten. Die Bücher 1–6 enthalten biblische Geschichte, in die Malalas historische und mythologische Überlieferungen zur altorientalischen und griechischen Geschichte eingearbeitet hat. In Buch 7 wird die römische Frühzeit behandelt, Buch 8 ist Alexander dem Großen und der hellenistischen Geschichte gewidmet, Buch 9 der Vorgeschichte des Prinzipats des Augustus. Die Werkmitte (ab Buch 10) bildet mit der gleichzeitigen Menschwerdung Christi und der Herrschaft des Augustus einen erkennbaren Einschnitt. Die Bücher 10–12 umfassen die Kaiserzeit bis Diokletian (284–305), während die folgenden beiden Bücher die spätantike Geschichte von Konstantin (306–337) bis Leon II. (474) beinhalten. Bis zu diesem Punkt beruht die Chronik des Malalas auf schriftlichen Quellen, wohl vor allem auf früheren, heute verlorenen Chroniken. Ab Buch 15 behandelt jedes Buch die Herrschaft eines einzelnen Kaisers: Buch 15 die Herrschaft Zenons (474–491), Buch 16 die des Anastasios (491–518), Buch 17 die Justins I. (518–527), das besonders umfangreiche Buch 18 schließlich die Herrschaft Justinians (527–565). Für diese Bücher konnte sich Malalas auch auf mündliche Berichte bzw. Autopsie stützen, wie er ausdrücklich betont.
Die Überlieferung
Bei der Überlieferung der Malalas-Chronik ist zwischen Buch 1 und den Büchern 2–18 zu unterscheiden. Hauptzeuge für Letztere ist der Codex Bodleianus Baroccianus 182 aus dem 11. / 12. Jh., eine Handschrift, die leider erhebliche Beschädigungen und Verluste aufweist. So fehlen Buch 1, Teile von Buch 5 und 18 sowie der Schluss des Werkes ab dem Jahr 563. Überdies ist mittlerweile klar, dass der Baroccianus nicht den Originaltext (sog. ‚Ur-Malalas’) bietet, sondern eine später überarbeitete und, v.a. in den Büchern 17–18, teilweise erheblich gekürzte Fassung.
Zur Ergänzung dieser Lücken müssen Autoren, die noch den ‚Ur-Malalas’ (oder ihm nahestehende Versionen) benutzt haben, ausgewertet werden, insbesondere Johannes von Ephesos, Euagrios, das Chronicon Paschale, Johannes von Nikiu, die Theophanes-Chronik sowie die Exzerpte des Konstantinos VII. Porphyrogennetos. Dazu kommen noch der Laterculus Malalianus, ferner eine, ihrerseits nicht vollständige, slawische Übersetzung aus dem 10. / 11. Jh. sowie die sog. Fragmenta Tusculana – Auszüge aus dem Text, die wohl noch im 6. Jh. oder am Anfang des 7. Jh., also nahe an Malalas’ Zeit, entstanden sind. Das 1. Buch der Chronik ist noch in zwei Handschriften aus dem 10. Jh. überliefert, allerdings ebenfalls in einer nachträglich überarbeiteten Fassung.