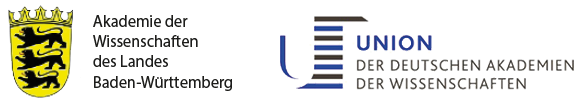Silizium ist nicht alles. Zur Materialproblematik der modernen Elektronik.
Albrecht Winnacker
Heidelberger Akademische Bibliothek
Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 2025
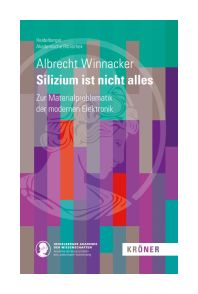
Das ›Silicon Valley‹ ist Geburts- und Standort der großen Technologiekonzerne wie Apple, Google und INTEL, ›Silicon Technology‹ die Basis großer technischer Innovationen incl. der Künstlichen Intelligenz, basierend auf der spektakulären Entwicklung der ›Chips‹; man spricht sogar vom ›Siliziumzeitalter‹. Diese einseitige Hervorhebung eines elektronischen Materials wird allerdings der technischen Realität nicht gerecht. Elektronisches Silizium stellt zwar die Materialbasis für Schlüsseltechnologien unserer Zeit dar, es zeigt sich aber, dass Silizium-basierte Elektronik in Technologiefeldern wie der E-Mobilität, der Photovoltaik oder der hochfrequenten Kommunikationstechnik keineswegs anderen Lösungen überlegen ist; für wichtige Anwendungsbereiche wie die Erzeugung von Licht für Beleuchtung oder optische Datenübertragung ist sie sogar ganz ungeeignet.
Der Problematik der elektronischen Materialien im Technologiegeschehen unserer Zeit geht dieses Büchlein nach unter dem Motto: ›Silizium ist nicht alles!‹ (Verlagstext)
Caesarius von Heisterbach: Libri VIII miraculorum – Die „Acht Wunderbücher“.
Auswertung, Edition, Übersetzung und Kommentar.
Julia Burkhardt (Hrsg.), Isabel Kimpel (Hrsg.)
Heidelberg, Heidelberg University Publishing, 2025
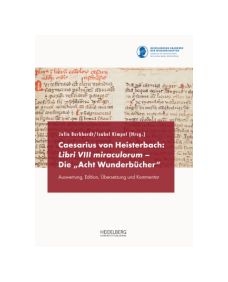
Der Zisterziensermönch Caesarius von Heisterbach (ca. 1180–1240) gehört zu den bekanntesten Autoren des Mittelalters. Seine „Acht Wunderbücher“ (Libri VIII miraculorum) sind eine Sammlung von Material zur Belehrung, Erbauung und Abschreckung: Erzählungen über Heilige und Dämonen, über Menschen und Tiere, über kleine Wunder und große Unglücke. In seinen Geschichten nimmt Caesarius das Publikum mit auf eine Reise, die vom Rheinland bis ins Baltikum und nach Jerusalem führt. So entsteht ein facettenreiches Panorama der politischen, sozialen und religiösen Entwicklungen im 13. Jahrhundert.
Die Neu-Edition der „Acht Wunderbücher“ bietet eine kommentierte Fassung des lateinischen Textes, erstmals eine deutsche Übersetzung sowie eine Auswertung des Werkes und seiner handschriftlichen Überlieferung. (Verlagstext)
Warum alte Texte lesen? Lesen als Mitarbeit am Text.
Michael Erler
Heidelberger Akademische Bibliothek
Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 2025
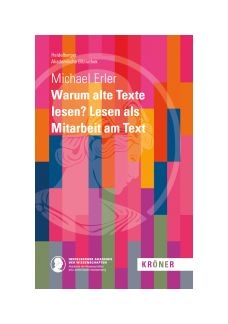
Jeder, der sich mit antiken Texten befasst, wird wohl schon einmal mit der Frage nach der Relevanz dieser Lektüre konfrontiert gewesen sein. Die moderne Philologie hat sich darüber viele Gedanken gemacht. Hier soll daran erinnert werden, dass und wie dies schon in der Antike geschah. Anlass sind Zeugnisse neueren Datums aus dem Kontext der epikureischen Philosophie, in denen eine philologische Beschäftigung mit Texten mit dem Anspruch verbunden wird, neben dem Text selbst auch die Relevanz der Lektüre für die Rezipienten im Blick zu haben. Diese Haltung wird moderne Philologen irritieren. Man mag geneigt sein, sie als weitere Besonderheit der epikureischen Schule zu registrieren. Sieht man genauer hin, erweist sie sich jedoch als eine Facette der antiken Lesekultur, die man bis in die Kaiserzeit verfolgen kann und deren Merkmale ansatzweise schon bei Platon diskutiert werden. Diese ›aktive‹ Leseweise verdient auch deshalb Aufmerksamkeit, weil Strukturelemente antiker Texte offenbar an diese Lesehaltung appellieren und mit Blick auf sie Profil erhalten. Indem sie Verantwortung der Leser für Konstitution und Deutung von Texten voraussetzt und reflektiert, verleiht sie modernen Positionen (›Geburt des Lesers‹) historischen Hintergrund und kann zudem vielleicht einen antiken Beitrag zur modernen Nützlichkeitsdebatte leisten. (Verlagstext)
Images, Gestures, Voices, Lives.
What Can We Learn from Paleolithic Art?
Miriam Noël Haidle, Nicholas J. Conard, Sibylle Wolf, Martin Porr (Hrsg.)
Heidelberg, Heidelberg University Publishing, 2025

Das Konzept der „paläolithischen Kunst“ und ihre Erforschung haben sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert. Der moderne Begriff der „Kunst“ ist kulturübergreifend und diachron problematisch. Das Phänomen lässt sich nicht auf die materielle visuelle Kultur reduzieren, sondern hat auch akustische, haptische und andere dynamische Aspekte. Sie muss als eine Vielfalt von Prozessen verstanden werden, die sowohl das Alltägliche als auch das Außergewöhnliche umfassen können. In diesem Band nähern sich Archäologen, Philosophen und Anthropologen der „paläolithischen Kunst“ aus verschiedenen Blickwinkeln, einschließlich ihrer Konzeptualisierung, Ästhetik, Beziehungen zur Kunstgeschichte und zur Art brut. Die Beiträge befassen sich mit der Herausforderung durch die Materialität, mit evolutionären Aspekten, mit der körperlichen Nachstellung durch Schauspieler und digitalen Technologien als Mittel zur Interpretation von Kunstobjekten sowie mit dem Schutz des kulturellen Erbes. Der Band bietet innovative Einblicke in vergangene Praktiken und zeitgenössische Ideen und Ansätze im Zusammenhang mit der paläolithischen Kunst, die auf sorgfältiger empirischer Forschung in Verbindung mit reflektierten und anspruchsvollen theoretischen Ansätzen basieren.