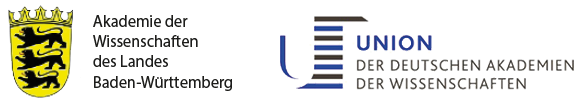Laufzeit: 1962 bis 2021
Der DAG (Dictionnaire onomasiologique de l’ancien gascon) und der DAGél (Dictionnaire d'ancien gascon électronique) erfassen auf breiter Grundlage den ältesten dokumentierten Sprachstand des Gaskognischen (11.-15. Jh.). Bei den ausgewerteten Quellen handelt sich um dokumentarische Textsorten (Urkunden, Register, Stadtrechte), da im Mittelalter keine Belletristik und nur vereinzelt religiöse Literatur und Fachtexte in der Gaskogne verfasst wurden. Diese Eigenart, die z.B. auch das Sardische oder das Frankoprovenzalische auszeichnet, ist letztlich der Grund, warum der ältere gaskognische Wortschatz nie systematisch aufgearbeitet wurde und warum der DAG eine der grossen Forschungslücken der Romanistik füllt.
Das Gaskognische ist eine markante Varietät in der Romania, die neben dem Französischen, dem Frankoprovenzalischen (Lyon, Grenoble, Westschweiz, Aosta-Tal) und dem Okzitanischen eine der vier Ausprägungen des Galloromanischen darstellt. Es ist typologisch und genetisch im grösseren Zusammenhang des Okzitanischen, des Katalanischen und des Aragonesischen zu sehen, also im Übergang von Gallo- zu Iberoromania. Eine besondere Nähe zum Okzitanischen (Südokzitanisch: Languedocien und Provençal, Nordokzitanisch: Arverno-Limousin und Dauphinois) ist unverkennbar, zugleich aber auch eine Reihe relevanter Unterschiede. Man kann davon ausgehen, dass das (Proto)Gaskognische schon um ca. 600 seine charakteristischen Spezifika im Bereich des Lautstands herausgebildet hat (cf. Chambon/Greub 2002, 489). Dazu gehört auch bereits die Aussprache [b] für /v/, die Joseph Justus Scaliger (1540-1609) später zu dem berühmten Wortspiel über die Gascogner verleitete: Felices populi, quibus vivere est bibere.
Verschiedene externe Faktoren haben das Gaskognische linguistisch geprägt: Seine Randlage in der Galloromania, am Atlantik und am Nordabhang der Pyrenäen, der frühe Kontakt mit dem Baskischen und eventuell auch anderen nicht indogermanischen Sprachen, drei Jahrhunderte unter englischer Herrschaft (1152-1451/53), dann aber auch die geographische, politische und infrastrukturelle Nähe zum südfranzösischen Macht- und Kulturzentrum Toulouse.
Trotz der unbestrittenen linguistischen Sonderstellung des Gaskognischen ist der DAG das erste lexikographische Unternehmen, das spezifisch dieser Varietät gewidmet ist. In der Anfangszeit (ab 1955) unter der Leitung von Kurt Baldinger noch parallel zum DAO (Dictionnaire onomasiologique de l’ancien occitan) geführt, wurde die Redaktion des DAOs im Jahr 2006 nach der Ausarbeitung eines neuen Konzepts durch Jean-Pierre Chambon (DAG_1300), gestoppt. 2014 wurde neben der – kondensierten – Druckversion des DAG ein erweitertes und neu konzipiertes elektronisches Wörterbuch unter der Leitung von Martin Glessgen und in Zusammenarbeit mit Sabine Tittel unternommen (DAGél). Der DAGél läuft seither als paralleles Projekt zum DAG_1300.
Die onomasiologisch orientierte Betrachtungsweise mit ihrem Darstellungsprinzip nach Wortinhalten erschließt die Lexik des administrativen und juristischen Korpus besonders anschaulich in Bezug auf Gesellschaft, Wirtschaft und Alltagskultur einer mittelalterlichen bisher wenig erforschten Sprachgruppe. DAG/DAO sind die ersten begrifflich gegliederten Wörterbücher zur linguistischen Situation im gesamten südfranzösischen Sprachraum des Mittelalters.
Das Projekt konnte Ende 2021 mit der abgeschlossenen Publikation des Wörterbuchs erfolgreich beendet werden.