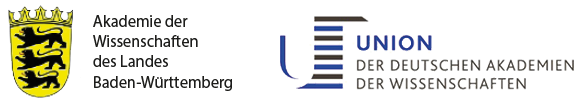Aufgrund technischer Schwierigkeiten ist die Datenbank zur Zeit nur aus dem Universitätsnetz Heidelberg oder via eduroam erreichbar. Wir versuchen die Funktionalität so rasch wie möglich wiederherzustellen und bedauern die Unannehmlichkeiten.
Das Regestenwerk
Im Zuge der Regestierung waren die Texte zunächst chronologisch zu ordnen. Zu diesem Zweck musste der Inhalt auch der verschlüsselten Privatschreiben verstanden und in Bezug zu den bekannten Ereignissen der Zeitgeschichte gesetzt werden. Die oft nur mit dem Vornamen genannten Personen mussten identifiziert werden. Aus all diesen Informationen waren schließlich die paraphrasierenden und kommentierenden Inhaltsangaben (Regesten) nach festen Regeln (vgl. die Einleitung von Band 1 [1977]) zu erstellen. Diese Teilaufgabe ist beendet; der gesamte Briefwechsel ist in einem 9-bändigen Regestenwerk erfasst.
Eine weitere Aufgabe besteht in der Erstellung von Indizes der Orte und Personen auf der Grundlage der Regesten. Auch diese Register haben Kommentar-Funktion: Im Ortsregister (Bd. 10) sind die 1475 Orte sowohl in ihrer damaligen als auch in ihrer heutigen politischen Zugehörigkeit identifiziert. Das Personenregister (Bde. 11–16) bietet die biographischen Daten der ca. 7000 in Melanchthons Briefwechsel erwähnten Personen mit weiterführender Literatur. Seit 2010 stehen die Regesten auch als Datenbank im Internet zur Verfügung.
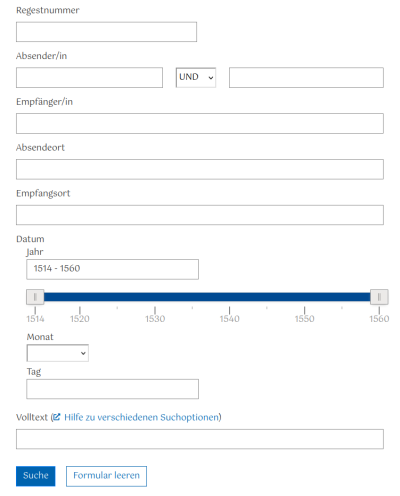
Melanchthon-Autographen
Im Rahmen zahlreicher Digitalisierungsprojekte stellen etliche große, aber auch kleinere Bibliotheken und Archive handschriftliches Material auf ihre Webseiten und machen es so nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sondern allen Interessierten zugänglich. Unter diesen digitalisierten Handschriften befindet sich auch eine stattliche Anzahl an Originalbriefen Philipp Melanchthons, die teils als Einzelstücke überliefert, teils in ganzen Bänden zusammengefasst sind.
Als Bindeglied zwischen unserer Edition und den Handschriften haben wir die uns bekannten Digitalisate von Melanchthon-Briefen in einer Liste zusammengestellt und ermöglichen über Links einen leichten Zugang zu diesen Handschriften. Berücksichtigt wurden nur Autographen Melanchthons, Abschriften oder Briefe an Melanchthon sind nicht erfasst.
Autographen (nach Aufbewahrungsort)
Bibliographie MelLit
Die Bibliographie „MelLit“ ist im Rahmen der Edition von Melanchthons Briefwechsel an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften entstanden. Sie bietet Zugriff auf die seit 1991 erschienenen Forschungsbeiträge zu Philipp Melanchthon (1497–1560) und ergänzt die bereits bestehenden bibliographischen Hilfsmittel zu Leben, Werk und Wirkung des Humanisten und Reformators. Neben Monographien und Sammelbänden sind auch Aufsätze und andere Kleinformen verzeichnet. Die Bibliographie wird laufend ergänzt.
Die Camerarius-Briefausgabe
Liber Continens Continva Serie Epistolas Philippi Melanchthonis Scriptas Annis XXXVIII. Ad Ioach. Camerar. Pabep.
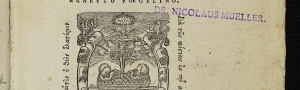
Der Briefwechsel zwischen Philipp Melanchthon und seinem lebenslang besten Freund, dem Gräzisten Joachim Camerarius (1500–1574), bildet mit rund 670 erhaltenen Briefen aus den Jahren 1522–1560 eine außergewöhnlich dicht und gut überlieferte Einzelkorrespondenz. Für die Bewahrung dieser Briefe hat vor allem Camerarius selbst gesorgt: Er hat die an ihn gerichteten Briefe Melanchthons sorgsam gesammelt und neun Jahre nach dem Tod des Reformators publiziert. Seine 1569 in Leipzig erschienene Ausgabe enthält nicht weniger als 591 an ihn adressierte Schreiben Melanchthons. Der Umstand, dass sich anderswo lediglich neun weitere an Camerarius gerichtete Briefe Melanchthons erhalten haben, lässt die überlieferungsgeschichtliche Bedeutung der Ausgabe von 1569 eindrucksvoll hervortreten: Sie bildete jahrhundertelang den Textus receptus dieser Einzelkorrespondenz und liegt noch den 1834–1842 publizierten ersten zehn Bänden des Corpus Reformatorum (mit den Melanthonis Epistolae) zugrunde. In Melanchthons Briefwechsel wird sie als CamD geführt.
Als dann in den 1870er Jahren in zwei Handschriftenbänden der Biblioteca Apostolica Vaticana (Cod. Chis. J VIII 293 und 294), die im 17. Jahrhundert in den Besitz der römischen Adelsfamilie Chigi gelangt waren, die Autographen von Melanchthons Briefen an Camerarius entdeckt und zugänglich wurden, stellte sich heraus, dass Camerarius diese Briefe für seine Ausgabe nicht unwesentlich verändert hatte: Dabei hat er nicht nur formale, orthographische oder stilistische Änderungen vorgenommen, sondern den Wortlaut häufig auch dadurch modifiziert, dass er im Brief begegnende Eigennamen durch Decknamen ersetzte, kritische Einlassungen Melanchthons abschwächte oder konkret formulierte Äußerungen verallgemeinerte. Mitunter hat er auch Passagen ausgelassen oder einzelne Wendungen oder ganze Sätze interpoliert.
Der Philologe und Kirchenhistoriker Nikolaus Müller (1857–1912), der sich von 1883 bis 1885 in Rom aufhielt, hat den Camerarius-Text mit den Melanchthon-Autographen der Chigi-Bibliothek vor Ort aufmerksam verglichen. Sein persönliches Handexemplar des Druckes von 1569 hatte er zu diesem Zweck mit leeren Blättern durchschossen und neu binden lassen. In dem dergestalt präparierten Exemplar verzeichnete Müller minutiös alle Abweichungen der Druckfassung von den Autographen, wobei er nicht nur die meist schon in das jeweilige Autograph hineinkorrigierten Änderungen des Camerarius genau dokumentierte, sondern auch Melanchthons eigene Streichungen und Verbesserungen, die gelegentliche Verwendung roter Tinte, eine abweichende Orthographie, veränderte Groß- und Kleinschreibungen sowie selbst so marginale Details wie die originale Schreibung von „et“ statt der im Druck verwendeten Ligatur „&“ festhielt. Allein dieses letzte Detail („et“ statt „&“) ist in Müllers Kollation insgesamt wohl Tausende von Malen angemerkt! Wie akribisch er gearbeitet hat, verdeutlicht auch seine 1901 erschienene Einzeledition von Melanchthons berühmtem griechischen Brief vom 16. Juni 1525 (MBW 408), durch den Camerarius über Luthers Heirat informiert wurde.
Das einzigartige Handexemplar Müllers, das aus dessen Nachlass über mehrere Stationen in die Heidelberger Melanchthon-Forschungsstelle gelangt ist (vgl. MBW, Bd. 1, S. 23), bildet mit seinen filigranen, durch zahlreiche Kürzel zusätzlich verdichteten Eintragungen in Sütterlinschrift, die zumeist mit roter oder schwarzer Tinte, mitunter aber auch mit Bleistift vorgenommen wurden, für die Editoren in Heidelberg seit jeher ein wichtiges Arbeitsinstrument. In den MBW-Textbänden wird bei Melanchthons Briefen an Camerarius im Vorspann ausdrücklich auf dieses Exemplar verwiesen. Auf Initiative der Forschungsstelle wurde es 2017 im Rahmen der Kooperation mit der Universitätsbibliothek Heidelberg digitalisiert und der Allgemeinheit frei zugänglich gemacht.
Literatur
Nikolaus Müller: Das Schreiben Melanchthons an Joachim Camerarius vom 16. Juni 1525 über Luthers Heirat, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 21 (1901), S. 595–598.
Heinz Scheible: Überlieferung und Editionen der Briefe Melanchthons, in: Heidelberger Jahrbücher 12 (1968), S. 139–142.
Christine Mundhenk: Briefe, in: Günter Frank (Hg.): Philipp Melanchthon. Der Reformator zwischen Glauben und Wissen. Ein Handbuch (2017), S. 306–308.
Matthias Dall’Asta: Melanchthons Briefe an Joachim Camerarius – eine Relektüre im Horizont ihrer Neuedition, in: Thomas Baier (Hg.): Camerarius Polyhistor. Wissensvermittlung im deutschen Humanismus (2017), S. 301–322.